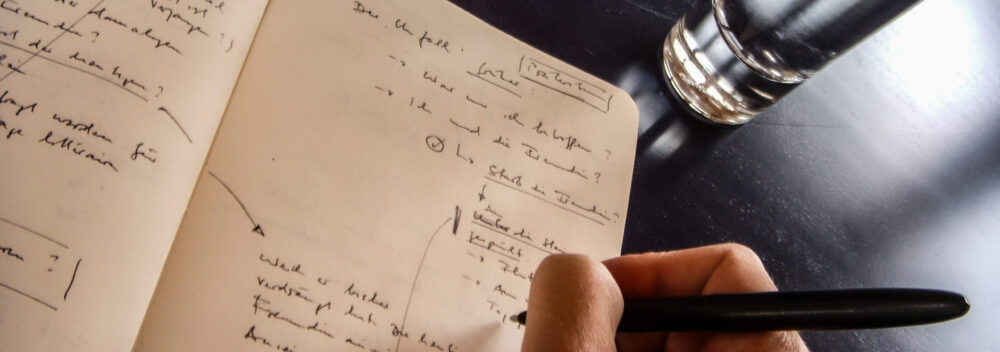Von Lena Franke
«Der Himmel sieht schön aus heute.»
Das war der einzige Satz, der an diesem Morgen über ihre Lippen kam mit einer nüchternen Bestimmtheit, die mich innehalten liess. Ich hob den Kopf und betrachtete das Blau über uns.
Der Himmel sah schön aus heute. Das war einfach so. War einfach so, weil Blume das so sah.
Ich schaute zu ihr hin und bemerkte, dass sie mich musterte. Ich wollte ihr eine Antwort geben. Sie ermutigen, mehr zu erzählen. Mehr vom Himmel vielleicht, oder von irgendetwas anderem.
Alles, was Blume erzählte, war schön.
Ich setzte an, doch ihr Blick liess mich meine Worte vergessen.
Dann wandte sie sich wieder ab, als hätte sie nie etwas gesagt.
Wenn Blume sich nachts in den Schlaf weinte. Gegen die Wand klopfte. Dann schaute sie mich manchmal hilflos an. Wir suchten zusammen nach Antworten auf all die Fragen, die sie innerlich zerrissen. Wir suchten ein Mittel gegen den Schmerz, für den sie keine Worte fand. Sie war ja noch ein Kind. Ich legte ihre Hände in meine, streichelte sie. Doch sie wand sich mit einer ganz und gar unkindlichen Kraft, riss sich los und klopfte weiter. Gegen die Wand. Und immer der Blick. Die stummen Tränen. Die Verzweiflung. Der Vorwurf.
Blume konnte man nicht festhalten.
Manchmal wehten am Morgen weisse Laken im Wind. Wenn ich früh aufgestanden war, um zu waschen. Ich hatte die Bettwäsche so lange geschrubbt, bis die Blutflecken verschwunden waren. Die Laken wieder weiss.
Wenn Blume mit den ersten Sonnenstrahlen durch das Gartentor trat, stand ich bereits in der Küche und heizte den Ofen. Lange hatte ich nicht gewusst, wohin sie jeweils so früh verschwand. Bis mir der Fischer erzählt hatte, dass er jeden Morgen ein kleines Mädchen im Nachthemd beobachte. Es stehe einfach da, schaue aufs Wasser. Wenn Blume zurückkam, tapste sie mit nackten Füssen zu mir in die Küche, schaltete das kleine Radio an, suchte einen Sender. Kurz darauf war der offene Raum erfüllt von Jazzmusik. Wir bewegten uns im Rhythmus, den das Radio vorgab, ohne Worte, wie jeden Tag bereiteten wir das Frühstück vor. Ich formte den Teig und schob ihn in den Ofen, während Blume in den Garten verschwand, um Gemüse, Früchte oder Kräuter zu holen. Manchmal hüpfte sie dabei und lächelte mich an. Und die Schatten der Nacht verschwanden.
Blume kam und ging. Die Tage kamen und gingen. Wie die Wellen, die in einem ewigen Kampf immer wieder aufs Neue an den Felsen zerschellten. Die Anwesenheit von Blume gehörte zu meinem Leben im weissen Haus auf der Klippe wie die mächtigen Geräusche der Brandung. Und es gab Tage, da wusste ich nicht, wem meine erste Erinnerung galt. Dem Herzschlag des Meeres oder Blume.
Ihren Namen hatte Blume im Garten unter den Orangenbäumen gefunden. Nach all den Jahren, in denen sie stumm gegen jeden meiner Namen gekämpft hatte. Den Worten weit fremder als den Seevögeln, die lautlos ihre Kreise zogen. Sie hatte mich nur immer angeschaut. Mit diesem Blick. Und das Klopfen nachts war schlimmer geworden, lauter, unerträglich. Also hatte sie keinen Namen gehabt. Bis zu jenem Tag im Garten, an dem sie die weisse Blume fand unter den Orangenbäumen.
Und mit ihr die Sprache.
Und alles, was Blume erzählte, war schön.