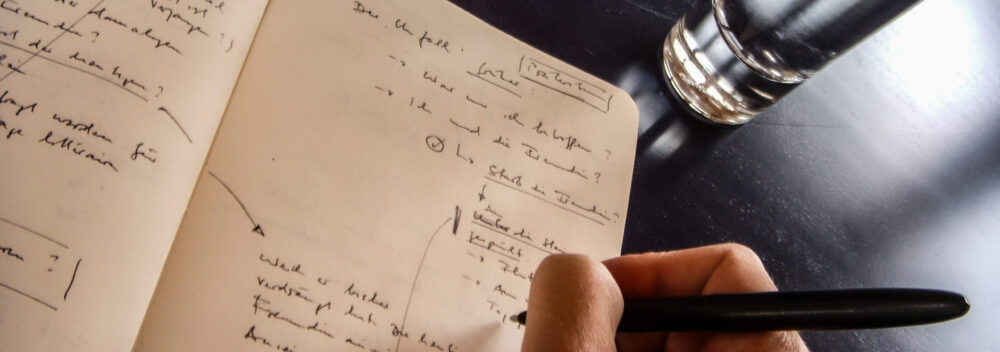Von Samira Fischer
Ein Rauschen in den Ohren, das Herz fühlt sich an, als würde es gleich aus der Brust springen, die Lunge schreit, und mein ganzer Körper schmerzt. Mein Verstand ermahnt mich aufzuhören. Aber die Wut treibt mich an. Immer weiter, immer tiefer hinein in den Wald. Und ich denke an gar nichts. Nur an die Worte meiner Mutter. Sie hallen in meinem Kopf, machen mich wahnsinnig.
Es ist so weit. Mehr musste sie nicht sagen. Ich habe sofort gewusst, dass es endlich passiert ist. Wir beide haben diesem Tag entgegengeschaut. Wir beide haben gewusst, dass es so nicht weitergehen konnte. Wir haben gelitten. Unter seinem Verhalten, unter seinen Beschuldigungen, unter seiner – Existenz. Und jetzt ist es passiert. Mein Vater ist weg.
Ich habe mir oft vorgestellt, wie es wäre, wenn er einfach gehen würde. Wenn meine Mutter ihn rausschmeissen würde. Mein Kopf hat sich zahllose verschiedene Varianten zurechtgelegt. Aber jetzt ist alles anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich fühle mich nicht erleichtert, bin nicht traurig, habe auch sonst keine Emotionen, die passen würden. Das Einzige, was ich verspüre, ist Wut. Ich bin wütend, dass es mir nichts ausmacht. Er ist weg und es ist mir egal.
Ein Schrei hallt durch den Wald, fährt mir durch Mark und Bein. Es dauert einen Moment, bis ich bemerke, dass der Schrei von mir kommt. Ich renne nicht mehr, ich stehe nicht mehr, ich liege gekrümmt auf dem nassen Boden. Und ja, ich schreie. Ich schreie, so laut ich kann. Die Wut ist weg, was ich höre, ist der Schmerz. Die Verzweiflung. Meine Atmung stockt, in meiner Brust wird es kalt und heiss und alles zieht sich zusammen.
Ein einziger Schrei sprengt die perfekte Mauer, die ich jahrelang aufrechterhalten habe. Ich werde schlaff, ich werde weich, und alles in mir bettelt aufzugeben.
Immer noch liege ich auf dem Boden, das Gesicht im Matsch, beide Hände von mir gestreckt. Dann spüre ich das Herz. Es ist der einzige Muskel, der will, dass ich weitermache. Ausgerechnet. All die Wunden, all die Narben. Aber es ist der einzige Muskel, der sich daran erinnert, was ich in meinem Leben geschafft habe. Vierzehn Jahre lang habe ich meinem Vater standgehalten. Seinen wütenden Beleidigungen, seinen Demütigungen und dem ständigen Vorwurf, dass ich eine Enttäuschung sei. Er hat Unrecht. Ich habe Freunde, bin gut in der Schule, lebe meine Leidenschaft aus. Mit einer Spraydose voller Farbe kann ich der Welt trotzen. Kann ich der Welt zeigen, dass nicht immer alles, was schön scheint, auch wirklich schön ist, und vor allem kann ich zeigen, dass ich existiere und mein Vater im Unrecht ist. Er hat nie Recht gehabt. Ja, manchmal fühle ich mich einsam, weil ich niemandem ganz vertrauen kann. Wie auch, wenn die Person, die hätte mein Vater sein sollen, mich jahrelang unterdrückt und kleingemacht hat.
Aber ich bin kein Mensch, der einfach aufgibt. Ich bin ein Mensch mit Herz. Ich brauche nur ein bisschen mehr Fokus. Tief durchatmen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich setze mich auf, zwinge mich auf die Füsse. Meine rechte Hand wandert zu den Kopfhörern und zum Handy, die linke Hand fährt über das feuchte Gesicht. Langsam, fokussiert stecke ich die Kopfhörer in die Ohren, drehe die Musik so laut auf, wie ich kann. Ich atme, gehe Bewegungsabläufe durch, setze mein Leben wieder zusammen, als wäre es ein Puzzle. Ein Teil zum andern, und am Ende hat man ein fertiges Bild vor sich. So mache ich es. Ich gebe meinem Kopf so viel Luft wie möglich, bis ich wieder sehe, weshalb ich noch lebe.
Mein Leben. Ich bestimme, was ich bin und wo es hingeht. So wird es auch bleiben. Niemals werde ich den Fokus, die Konzentration und die Willenskraft verlieren. Das bin ich nicht.
Und jetzt gehe ich zurück. Voran, dahin, wo er nicht ist.