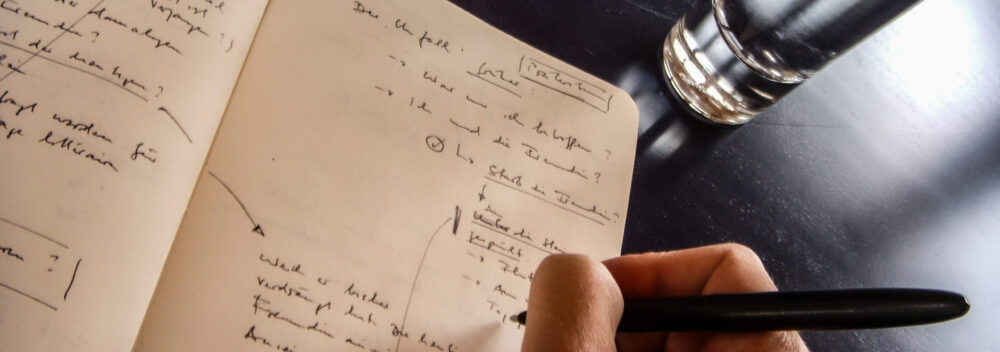Von Tabea Geissmann
Bahnfahren hat etwas Therapeutisches an sich. Häuser und Strassen und Bäume, die an dir vorbeiziehen und die Menschen draussen und drinnen, jeder mit einer eigenen Geschichte. Und ich sitze einfach da, mit meiner Musik, und muss nichts denken, weil die Welt ausserhalb gerade so ganz ohne mich funktioniert.
Auch heute sitze ich wieder hier, ohne ein wirkliches Ziel, und versuche Ordnung in das Chaos in meinem Kopf zu bringen. Letzte Woche sind wir noch hier zusammen gefahren und haben über Gott und die Welt geredet. Jetzt fahre ich allein zur Schule und bin allein mit den Gedanken, die ich nicht mehr mit dir teilen kann. Warum ist mir nicht aufgefallen, wie gut du zuhören kannst, als du noch hier warst?
Vorgestern sass ich in derselben Strassenbahn auf dem Weg nach Hause und hörte das neue Album, das du mir empfohlen hattest. Du warst nicht in der Schule gewesen, doch ich hatte mir nichts dabei gedacht, bei Frühlingswetter hattest du immer Migräne gehabt. Erst als mein Handy den Eingang einer neuen Nachricht anzeigte und ich deinen Namen auf dem Display las, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. SMS zu schreiben war nicht deine Art. Und hättest du wirklich Migräne gehabt, hättest du nicht auf deinem Handy herumgetippt, sondern wärst im abgedunkelten Zimmer geblieben.
Ich begriff die Bedeutung der drei Wörter nicht gleich. Ich muss zurück. Und als ich endlich verstand, fühlte ich nichts mehr. Die Tränen kamen erst später, als ich abends in meinem Zimmer sass und mir klar wurde, dass ich gerade meine beste Freundin verloren hatte – und das nur, weil in ihrem Pass nicht die passende Nationalität stand.
Letzten Winter hatten wir in Deutsch einen Aufsatz geschrieben. Wofür es sich zu kämpfen lohnt. – Seltsames Thema, hatte ich mir gedacht und nur belanglose Dinge aufgeschrieben, weil ich Aufsätze nicht leiden konnte und vor allem weil ich sowieso nichts zu sagen gehabt hätte. Du hattest eine Eins geschrieben, wie immer, weil deine Art, mit Worten umzugehen in jeder Hinsicht bemerkenswert war. Du durftest deinen Aufsatz in der Klasse vorlesen, und er wurde sogar in der Schülerzeitung abgedruckt. Du warst schon immer eine Kämpferin gewesen, und in deinem Aufsatz hattest du von dem Kampf erzählt, der dir am meisten bedeutete. Und den du schlussendlich doch verlorst: deutsch zu werden.
Ich kann und will nicht verstehen, warum du gehen musstest. Und weshalb ich nichts dagegen tun konnte. Du machtest die Haustür nicht mehr auf, als ich bei dir klingelte. Darauf versuchte ich bei allen möglichen Bekannten und Ämtern in Erfahrung zu bringen, wo du warst – oder wenigstens, weshalb du nicht mehr da warst. Deine Eltern hätten ihre Termine mit den Behörden nicht eingehalten. Das war der einzige Grund, den sie mir nannten. Du warst schon weg, und ich hatte nicht einmal mehr die Möglichkeit gehabt, mich von dir zu verabschieden. Und jetzt sitze ich hier, allein in einer Strassenbahn in Berlin, und du irgendwo in Afghanistan, einem Land, das dir doch völlig fremd ist.
Du warst mehr deutsch als ich. Du warst immer pünktlich und hast die Strasse nie bei Rot überquert. Du gucktest stundenlang RTL und DSDS, um mitreden zu können. In deinem Zimmer hing ein Bayern-München-Trikot an der Wand und bei der WM fiebertest du in der vordersten Reihe für Deutschland mit. Du konntest die besten Spätzle kochen und schlugst mich beim Bierwetttrinken immer um Längen. Du konntest ganze Passagen von Goethes Faust auswendig zitieren, und in Deutsch hattest du immer eine Eins.
Aber das alles war nicht deutsch genug. Den Pass haben weder du noch deine Eltern bekommen, dabei hättet ihr ihn am meisten verdient. Dass ihr gehen musstet, ist nicht fair. Nicht nach all dem, was ihr getan habt, um dazuzugehören. Du gehörtest genauso hierhin, wie ich hierhin gehöre. Berlin ist deine Heimat genauso wie meine, und an dein Leben vor Deutschland konntest du dich kaum noch erinnern. Trotzdem war es nicht deutsch genug. Das System hat euch aussortiert. Dabei hätten deine Eltern und du vielleicht bald den Einbürgerungstest schreiben können. Du hattest seit Langem dafür gelernt. Alles umsonst.
Jede Ecke hier in Berlin erinnert mich an dich und die Lieder in meiner Playlist kann ich nicht mehr hören, ohne an dich denken zu müssen. Zu lange warst du ein Teil meines Lebens und jetzt weiss ich nicht, ob ich dich jemals wiedersehen werde. Wir können nicht mehr über die Idioten an unserer Schule lachen, über Lehrer und Ex-Freunde lästern oder Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken. Wir können nicht mehr philosophierend in der Strassenbahn sitzen oder zuhause in einer Höhle aus Decken und Kissen Horrorfilme schauen. Ich habe nur noch die Fotos und Tagebücher, die wir gemeinsam schrieben, ein paar deiner T-Shirts und Pullis, die ich dir nicht mehr zurückgeben konnte, und den Aufsatz, den du letzten Winter geschrieben hast.
Jetzt sitze ich allein in der Strassenbahn und weiss nicht, wohin mit meinen Gedanken. Vielleicht hätte es Wege gegeben, dir zu helfen. Vielleicht hätte ich der Ausländerbehörde ein Beschwerdeschreiben schicken sollen. Ich habe nichts getan. Jetzt ist für alles zu spät. Aber ich werde deinen Aufsatz allen Berliner Zeitungsreaktionen schicken, denn die ganze Stadt soll deine Geschichte kennen. Es tut mir leid, dass ich es nicht weiter versucht habe. Doch ich möchte deinen Kampf weiterkämpfen, und bis ich deinen Aufsatz in der Zeitung lesen werde, kann ich nicht locker lassen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann; für meine beste Freundin, für die es sich immer zu kämpfen lohnt.