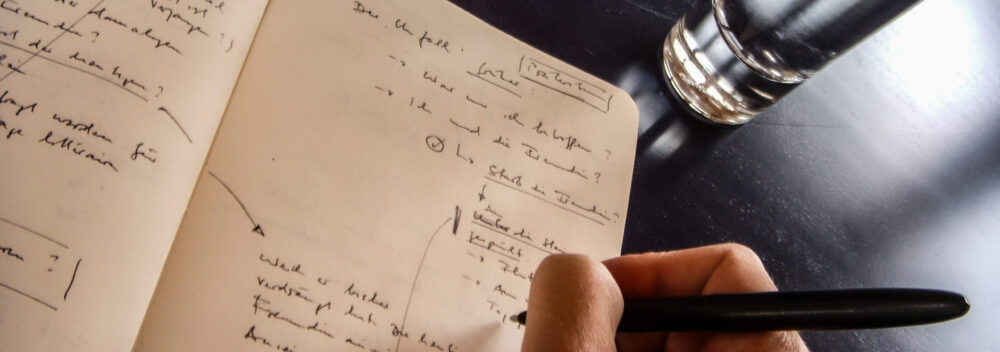Von Tatjana Gligorevic
Wieder derselbe Traum – dieselbe ungewohnte Stille.
Es liegt ein Weinen in der Luft.
Mit wiegenden Armen streicht der Wind über die Nebeldecke, die wie ein Meer von Wellen mal hin-, mal herschwappt. Heulend hebt er die Gestalten der Nacht aus den Schwaden. Im fahlen Mondlicht geistern sie umher.
Als sich erste Sonnenstrahlen über das Tal ergiessen, gehen alle in dieselbe Richtung. So viele Seelen, geblendet, mit geschlossenen Augen und leeren Händen tasten sie sich auf dem Weg voran.
Du legtest meinen Traum so aus, dass die Sonne die Quelle aller Blindheit war. Für mich war und ist sie zugleich ihr Ende. Das Licht. Keine Erkenntnis ohne Schmerz. Ich bin sicher, heute würdest du mir zustimmen, wenn es nicht anders gekommen wäre. Und du würdest lachen, wenn ich dir erzählte, dass ich seit Langem den Blick in den Spiegel gewagt habe. Das aschfahle Haar, die knochigen Finger, die tiefen Ringe um die Augen. All das passt nicht mehr.
Ist denn wirklich so viel Zeit vergangen, Hermann? Es ist, als hätte nächtelanges Träumen jedes Bewusstsein über ein Gestern und Heute in mir aufgelöst. Vielleicht hat es etwas Gutes, dass Träume die Erinnerung wachhalten. Auch wenn sie einen jede Nacht quälen. Noch immer.
Hermann, vor mir liegt dein Bild –, als würdest du ahnen, welches Schicksal du zu erfüllen hattest. Deine Geschichte, die Geschichte deiner Patienten – es ist nicht zu vergessen. Aber vielleicht helfen diese Zeilen hier, dem nächtlichen Spuk zu entkommen. Denn so weiterleben kann ich nicht.
Weisst du noch? Dezember 1943. Du erzähltest mir beim morgendlichen Rundgang von einer Unterstellung, die Koch, unseren Stationspsychiater, dazu veranlasst habe, das Gespräch mit dir zu suchen. Was genau hat er aus dir herausgebracht? Niemals hättest du dich an irgendwelchen Verbrechen beteiligt, das weiss ich. Dennoch: Was hast du Koch damals erzählt? Oder war es Bergmann? Feldwebel und Student der Medizin, Rückkehrer von der Ostfront. Der Neue auf der Station. Dieses Gesicht – sein Ausdruck hatte etwas von endlosem Sommer. Zum ersten Mal sah ich dich fassungslos, als ich dir seinen Namen nannte. Aber du beruhigtest dich schnell wieder. Ein Unglücklicher mehr in diesem Irrenhaus, dachtest du wohl.
Von Koch zu hören, ich sei zu vernünftig, um meine Nase in fremde Angelegenheiten zu stecken, war das eine. Das andere, von einem Geisteskranken ausgerechnet das Gegenteil gesagt zu bekommen. Ich solle genau hinschauen, sagte er, dann würde ich schon sehen. Richter. Nicht irgendein Geisteskranker. Es mag verrückt klingen; Aber es gab tatsächlich Momente, in denen er mir überhaupt nicht fremd vorkam. Gehörte er wirklich an diesen Ort?
Eines Tages gab es eine grundlegende Veränderung in seinem Verhalten. Der Blick, der sich mit der Selbstverständlichkeit kindlicher Neugier nach meinem Befinden erkundigte – er schien erloschen. Auf der Bettkante sass lediglich ein alter Mann, dem der Sturm da draussen wohl in die Gedankenwelt vorgedrungen war. Das in Fetzen gerissene Tagebuch von der Front lag neben ihm, und den selbst gesponnenen Kokon der Empfindungs- und Teilnahmslosigkeit wollte er nun nicht mehr verlassen. So setzte ich mich zu ihm ans Fenster, um in die weite Welt hinauszublicken. Sterne. Ein Lichtersee.
Ich konnte nur Bruchstücke von dem auffangen, was er sagte. Makellose Existenz. Fehlerhaftes Abbild. Von den Überresten seiner Persönlichkeit sprach er, und davon, dass er nicht länger das fehlerhafte Abbild seiner selbst sein wollte.
Es war ein seltsames Gefühl, am Fenster neben jemandem zu sitzen, dem der Krieg nach unseren Massstäben den Verstand geraubt hatte. Ich verstand ihn nicht, aber ich spürte ihn, fühlte mich ihm sehr nah. Mit einem Mal glitt eine Art Heiterkeit über seine Lippen. Wie erste Sonnenstrahlen nach dem Sturm. «Sie sind vieles, Schwester», sagte er, «aber zum Glück nicht vernünftig.»
Merkwürdig. Ich würde den Klang seiner Stimme immer noch unter hunderten wiedererkennen. Was hat mich mit ihm verbunden? Was verbindet mich mit ihm? Ich schreibe hier auf, was mich nicht loslässt – und er hat sein Tagebuch damals vor meinen Augen zerfetzt. Ist es möglich, dass er es aus demselben Grund tat, der mich zum Schreiben zwingt?
Ich weiss so vieles nicht. Auch was mit Richter schliesslich geschehen ist, weiss ich nicht. Ich befürchte, dass er zu den Unglücklichen zählt, die den Luftangriff nicht überstanden haben. Als die Warnung im Radio bekanntgegeben wurde, brach bei uns das blanke Chaos aus. Ich habe ihn nach dem Einschlag nie wieder gesehen.
Ein langer Tag war zu Ende, als ich mich ins Stationszimmer zurückzog. Mein Blick fiel auf eine einsame weisse Rose in einer Vase. Welke Lippen lächelten mir entgegen – versteift zu einem Ausdruck, der für die Ewigkeit bestimmt war. Ich konnte nicht umhin zurückzulächeln – und versank in Trübsinn. Wann begreift man, dass man dabei ist, den Verstand zu verlieren? Wenn man glaubt, eine Blume lächeln zu sehen? Wenn man dieses Lächeln erwidert? Jedenfalls spürte ich, wie mir das Lächeln eine letzte Wärme in meine Wangen trieb. Dann konnte ich weinen.
Die Tür sprang auf, ich wandte mich um. Der Mann, der hereinkam, erinnerte mich an ein umherstreifendes Gespenst. Das hohläugige Wesen warst du. Noch nie hatte ich dich so aufgewühlt erlebt. Du müssest etwas tun, sagtest du, wolltest runter, rauf – zum Ausgang. Du wolltest nach einer Blume suchen – im Winter! Hätte ich dich nicht daran gehindert, du wärst hoffnungsvoll nach draussen spaziert. Wie du mich angeschaut hast an jenem Abend. So enttäuscht, so traurig, so weit weg von jedem Verständnis. Deine Augen wanderten unentwegt über mein Gesicht und fanden keinen Halt. Vielleicht suchten sie auch nach etwas, nach Worten, die dir gesagt hätten, dass alles gut werden würde, oder nach Augen, die über deine Verzweiflung hinweggeblickt hätten.
Ich begleitete dich hinunter in den Bunker, wo wir seit dem Luftangriff die meiste Zeit hausten. Als ich da so neben dir sass, an diesem unbehaglichen Ort inmitten der vielen gesunden und kranken Menschen, wurdest du ganz ruhig. Und – ich weiss nicht – ich begann, dich zu bewundern. Wofür?
Eines Morgens erhob sich eine Stimme über unseren Köpfen. Zu Beginn dachte ich, ich hätte mich verhört, als die ersten Töne von Stille Nacht erklangen. Weihnachten war schon vor einigen Tagen unbemerkt an uns vorübergeschlichen. Es musste der wohlmeinende Versuch gewesen sein, etwas Versäumtes wiedergutzumachen.
Eine schöne Stimme, und es wurden immer mehr. Doch bezüglich des Textes schien es Uneinigkeiten zu geben. «Lichtsucher» war zu hören, und «Weihnachtswunder». Immer wieder auch «Grösse» und «unser Führer». Vor allem die Jungen setzten trotz vereinzelter Protestrufe mit stolz erhobenen Häuptern ihre perverse Version des Weihnachtsliedes fort. Ein schauriges Schauspiel.
Die Tage im Bunker zeichneten sich vor allem durch Schweigen und durch Entzweiung aus. Nicht eine Sekunde lang dachte ich daran, dieser längst verlorene Krieg sollte fortgeführt werden. Nun stellte sich aber die Frage, wie er denn enden sollte. Sieg behaupteten die Strammen. Kapitulation forderten die Realisten. Dazwischen das Schweigen. Eine quälende Stille. Doch sie bot uns beiden Anlass für weitere Unterhaltungen.
Im Bunker habe ich vieles über dich gelernt, Hermann. Unsere Träume haben wir uns erzählt, von deiner Begeisterung für Kunst habe ich erfahren, du erzähltest von deiner Frau, der kinderlosen Ehe. Und einmal erzähltest du von Bergmann, deinem früheren Kameraden von der Front. Mir war nicht entgangen, dass er während der Visiten kaum von deiner Seite wich, dass er auch sonst immer deine Nähe suchte. Oder war es umgekehrt? – Wie du von ihm erzähltest, Hermann. Dieses Flackern im Auge. Woher kam dieses Flackern? Wo lag die Glut? Damals ahnte ich noch nichts.
Du erzähltest von deiner letzten Begegnung mit Bergmann. Ihr wart auf der obersten Etage der Klinik. Ein Aufenthaltsraum. Ihr wart allein. Über der Stadt ambossförmige Rauchschwaden, glühende Feuer am Horizont. Und ihr zwei allein. Das Flackern, die Glut. Deine Worte wurden immer unklarer, du erschienst mir jetzt um Jahre gealtert. Oder warst du tatsächlich gerade dabei, verrückt zu werden? Was du preisgabst – mir kam es vor wie ein wunderbar rätselhaftes Gedicht.
Seine Stimme klang so sanft, wie ich sie nie gehört hatte –
zu unseren Füssen die brennende Stadt
über uns schauten die Sterne aus dem Himmel
auf uns herab,
die wir nicht wussten, was wir taten.
Aber rätselhaft war es nicht. – Denn ich verstand, was ich so lange zu verdrängen versucht hatte. Dich und ihn verband das, was uns beide voneinander fernhielt.
Zwei Wochen später ein letzter Händedruck, der letzte flüchtige Blick, Hermann. Ich versprach, in besseren Zeiten deine Geschichte zu erzählen. Dann wurdest du von zwei Beamten abgeführt. Wer dich verraten hatte? Du dich selbst?
Ob Koch etwas gewusst hat, weiss ich nicht. Aber an jenem Nachmittag hielt er mir einen langen Vortrag über deutsche Ehre, widernatürliche Veranlagung und kriegsbedingte Persönlichkeitsstörung. Ein gnadenloser Vortrag. Wie wird ein Mensch so hart, so kalt? Ein Mensch wie ein Stein.
Niemand sollte dazu berechtigt sein, ein Urteil über jemanden zu fällen, das allein Gott zusteht.
Gott, Barmherzigkeit und Gewissen – ist es nicht das, worauf wir uns beriefen, damals? Und heute ist es nicht anders. Hermann – was ist seelentötender, als sich dem inneren Verständnis von Recht und Unrecht zu widersetzen? Keiner weiss das besser als du. Nachdem Koch geendigt hatte, sass er da mit leerem Mund. Aus seinem Blick konnte ich lesen, dass er auch dir eine Chance geben würde, dich aus der Sache rauszureden. Der Preis war dir zu hoch. War es so? – Jedenfalls: Es war kein langer Prozess.
Wer hätte gedacht, dass deine Geschichte an demselben Ort ihr Ende finden würde, wo sie auch ihren Anfang nahm?
Du warst nicht mehr in der Lage, die Haftstrafe anzutreten. Also hatte man dich gewissermassen in deine eigene Klinik eingewiesen. – Als ich dein erschlafftes Handgelenk ergriff, war alles, was noch zu spüren war, ein schwaches Pochen. Ich bildete mir ein, dass du meine Bestürzung mitkriegen würdest. Das machte den Abschied erträglicher.
Um 21.30 Uhr sagte der Arzt, du würdest es in einer halben Stunde geschafft haben. Der Friede von damals war mittlerweile auf deinem Gesicht eingekehrt. Wie machtest du das bloss? Was war dein Geheimnis? Wenn ich ehrlich bin, wollte ich es nicht wissen. Aber der Schmerz über dein Schicksal machte einer tiefer Dankbarkeit Platz. 21.42 Uhr: Ich hob deine Hand erneut ein wenig an und entfernte den goldenen Ehering. Du liessest mich gewähren. Zumindest bildete ich mir das ein. Um 21.53 Uhr blieb die Uhr stehen.