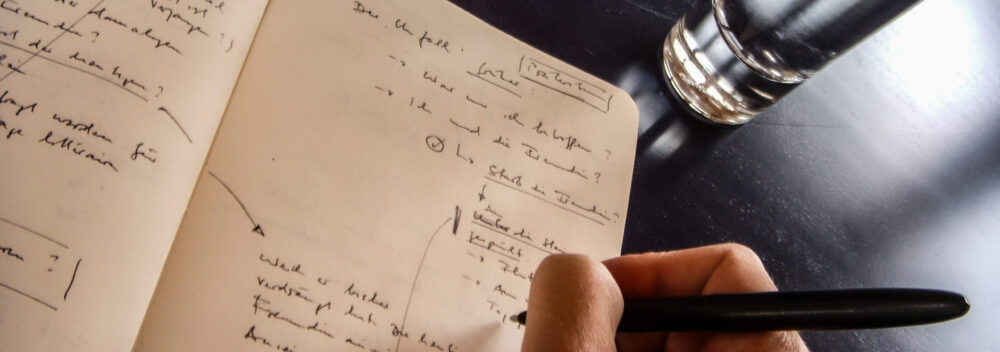Von Andjelka Antonijevic
Ich laufe gern barfuss herum, weil mir dann kalt und warm zugleich ist. So laufe ich jeden Morgen die kurze Strecke von meinem Zimmer in die Küche barfuss. Ich öffne den Kühlschrank und schliesse ihn ganz schnell wieder, wenn ich meine Litschis herausgeholt habe.
Meine Mutter sagt, dass barfuss laufen ungesund ist. Aber ich mag es, und ob ich jetzt gesund oder ungesund bin, spielt auch nicht so eine Rolle. Bei Litschis ist das wichtig. Ist es nicht warm genug, wachsen sie nicht, ist es zu sonnig, wachsen sie auch nicht. Ich würde eigentlich gerne eine pflanzen, ich weiss, wie man sich um sie kümmert. Ich weiss alles über Litschis. Sie wachsen nur, wenn man sie richtig behandelt.
Was ich aber am meisten mag, ist die Schale der Frucht. Ich mag es, wie die raue Oberfläche an den Fingerkuppen fast schon schmerzt, wenn man sie festhält, oder leicht drückt, bis sie fast aufplatzt. Ich streiche mal ganz sanft, mal stärker über die Schale, ab und zu halte ich sie an meine Wange oder fahre mit der Zunge darüber. Ein angenehmer Schauer kriecht dann über meinen Rücken.
Dann erinnere ich mich immer an diesen einen Nachmittag mit meinem Vater, im Wald. Die Litschi-Schalen fühlen sich genau gleich an wie die Rinden der Tannenbäume, an die ich meine damals noch kleinen Hände gedrückt habe. Mein Vater hat mich herumgeführt und mich jede Tanne anfassen lassen. Irgendwann ist er zwischen den Tannen verschwunden, und nicht mehr wieder gekommen.
Seitdem laufe ich morgens, bevor ich zur Schule gehe, barfuss herum und streichle die Schale von Litschis.
Eine Schule ist nichts für Litschis. Zu kalt ist es da. Viel zu kalt.
Nur auf dem Dach, da ist es nicht so schlimm. Dort kommt die Sonne hin, auf dem hohen Flachdach berührt sie die Haut direkt. Da könnte man eine Litschi aufstellen, die würde wachsen.
Aber jetzt ist Winter, und so ist mir mehr kalt, als dass mir warm ist.
Litschis kann ich so viele essen, wie ich will, und muss mir kein schlechtes Gewissen machen lassen von Mama. Die sagt nämlich, Litschis müssten sowieso schon mit dem Flugzeug hergebracht werden, weil sie es hier nicht warm genug haben, dann solle man sie wenigstens bei uns nur im Winter essen, weil sie nur dann gedeihen. Sie sagt auch, ich solle die essen, die in Europa geerntet werden. Um Mama richtig zu ärgern, kaufe ich von meinem Taschengeld Litschis, die von möglichst weit weg kommen. Vielleicht kaufe ich sie auch, weil ich mir vorstelle, wie es wäre, eine solche Litschi zu sein, die von möglichst weit weg kommt.
Wenn ich wieder daheim bin, versuche ich zu wachsen, denke über den Tag nach. Der Doktor nennt es reflektieren. Doch meistens war der Tag so langweilig, dass es da nichts nachzudenken gab. Nur einmal war er sehr spannend. Ich wollte einen Jungen küssen, weil ich doch noch nie einen Jungen geküsst hatte, aber er lachte mich nur aus. Dann lachten mich auch seine Freunde aus. Das machte nichts, weil ich schon früher für meine wöchentlichen Gänge zum Doktor ausgelacht worden war. Aber es lachten fast alle. Und sie hörten einfach nicht auf. An jenem Abend reflektierte ich lange.
Ich sitze im Bus auf dem Weg zur Schule und starre aus dem Fenster. Dann schlaf ich kurz ein, weil ich so gerne schlafe. Es gibt einen heftigen Ruck, der mich wieder aus diesem Traum reist, und ich starre wieder aus dem Fenster, nicht sicher, ob ich noch träume oder nicht. Und dann sehe ich es, ganz plötzlich. So komisch und merkwürdig, als würde ich noch immer schlafen.
Aus einem kleinen Fleckchen Erde neben der Strasse ragt ein hölzerner Stängel, ein Pflanzenstängel. Und die langen, schmalen, spitzen, glatten, hellgrünen Blätter verraten die Pflanze. Sie sehen ein wenig aus wie Ligusterblätter, doch es ist ein kleiner, ausgesetzter Litschibaum. Mitten im Winter! Jemand hat ihn dort gepflanzt, den armen! Die Erde um den noch ganz dünnen, jungen Stamm ist frisch. Jemand hatte nicht gewusst, dass die Litschi jetzt im Winter, wenn es so kalt ist, so sonnenlos, nicht wachsen würde.
Ich springe von meinen Sitz, niemand beachtet mich. Ich drücke den Knopf zum Aussteigen, doch der Buschauffeur fährt schon weiter Richtung Schule. Ich muss diesen Baum retten. «Halten Sie doch an!», rufe ich, doch der Fahrer hört mich nicht, oder hört mir nicht zu, also drängle ich mich nach vorne, direkt neben den Fahrer. «Halten Sie an!», sage ich nochmals, «sofort!» Ich kreische nun, und er sieht mich entsetzt an, öffnet die Tür. Der Bus bleibt stehen: empörte Rufe begleiten mich zur Tür hinaus. Der Fahrer springt mir nach, doch ich renne die Strasse entlang zum kleinen Litschibaum, der immer noch dort steht. Ich grabe mit den blossen Händen in der Erde, beachte den fluchenden Fahrer hinter mir nicht. Ich grabe und grabe im fast gefrorenen Boden. Irgendwann lässt der Fahrer kopfschüttelnd von mir ab, kehrt zu seinem Fahrzeug zurück. Er lässt mich in Ruhe, weil es vielleicht nicht das erste Mal ist, dass er sowas erlebt. Er scheint mich zu kennen. Meine Finger frieren ein.
Ich grabe behutsam um die Wurzeln herum, hebe die Pflanze vorsichtig aus der Erde und widerstehe dem Drang, sie wärmend zu umarmen. Ich nehme sie mit nach Hause und pflanze sie in einen Topf. Ich stelle sie in meinem Zimmer ans Fenster und drehe ein wenig die Heizung auf. Sie soll wachsen, ihr soll es gut gehen.
Als ich am nächsten Morgen neben ihr aufwache, mit erdigen Händen und barfuss, ich muss mir im Schlaf die Socken von den Füssen gestreift haben, erschrecke ich. Sie ist tot, ich sehe es sofort. Die Litschi ist tot. Ihre Blätter sind über Nacht gelb geworden. Ich gerate in Panik, giesse sie, warte Stunden lang darauf, dass die Blätter wieder grün werden. Ich hole sogar Dünger herbei, auch wenn ich nichts davon halte. Doch auch eine weitere traumlose Nacht bringt nichts Gutes. Der Stiel ist eingetrocknet, die Blätter abgefallen. Ich weine, ich versuche nachzudenken, zu reflektieren, doch es geht nicht. Ich nehme schluchzend den Topf in die Arme, bleibe einige Minuten so sitzen und halte die Litschi fest.
Ich gehe barfuss los, auf dem Dach ist es warm, dort würde sie wachsen, die Litschi, also laufe ich zur Schule, die Treppe rauf, die Nottreppe, die man eigentlich nicht benutzen darf. Auf dem Dach ist es warm, auf dem Dach wird sie wachsen. Ich stelle sie hin, hocke mich daneben, und warte und werde nicht weggehen, bis sie wieder wächst.